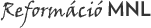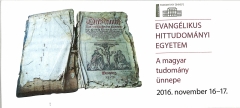Das Referat wurde am 16. November 2016. an der Lutherische -Theologische Universität gehalten.
Die anderen Vorträge, beziehungsweise das realisierte Programm sind hier erreichbar: http://www.evangelikus.hu
Konfessionswechsel oder Zusammenleben. Das Schicksal der Kirchen in den königlichen Freistädten
Mein Vortrag fußt auf ein 2016 begonnenes Forschungsprojekt, das durch das Ungarische Nationalarchiv und den ungarischen Reformation-Gedenkausschuss gefördert wird. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Anfangsphase des Konfessionswechsels zu untersuchen sowie entsprechende Quellen in allen Archiven der ehemaligen königlichen Freistädte Ungarns zu sammeln und der Forschung zur Verfügung zu stellen. Das Forschungsvorhaben wurde neben persönlicher Neugier durch das Reformationsjubiläum und jene eigenartige, wichtige Rolle motiviert, die diese Städte im Prozess der Konfessionalisierung spielten. Außerdem hat das Nationalarchiv sowohl traditionsgemäß als auch gesetzlich vorgeschrieben die Aufgabe, die sog. Hungarica-Forschungen voranzutreiben, d.h. Ungarn betreffende Archivalien in ausländischen Archiven zu erschließen.
Ödenburg und Güns ausgenommen befinden sich erhaltengebliebene Archive der ehemaligen königlichen Freistädte in der heutigen Slowakei sowie in Österreich und Kroatien. Die ungarischen Städte in dem sog. osmanischen Eroberungsgebiet haben leider ihre Archivalien völlig verloren. Im Laufe der Forschung werden die Quellen nicht nur erschlossen, sondern auch digitalisiert und dieses digitale Korpus wird den Forschern des Themas und der Epoche zur Verfügung stehen. Das Projekt bezweckt also auch auf dem Gebiet der frühen Reformation die Zusammenstellung einer solchen Sammlung, die bei uns bisher nie oder nur teilweise zustande gekommen ist. Es sind nämlich mehrere von den fraglichen Archivalien in den fünf Bänden der Monumenta ecclesiastica von Vince Bunyitay (Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából) oder in Sándor Payrs Kirchengeschichtlichen Denkmälern (Egyháztörténeti Emlékek) ediert worden. In den Bänden des besonders wichtigen Kirchengeschichtlichen Archivs des ungarischen Protestantismus (Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár) sind auch zahlreiche städtische Quellen abgedruckt worden. In der vor hundert Jahren florierenden konfessionellen Geschichtsschreibung zeichnen sich weiter jene Arbeiten aus, die evangelische Stadtgemeinden schildern.
Es ist also kein Zufall, dass der Ungarns historische Bibliographie zusammenstellende Domokos Kosáry nur anhand der gedruckten Literatur die Meinung äußert hat: „die realen Gründe von der Verbreitung des neuen Glaubens in Ungarn […] finden sich in den Städten, in der bürgerlichen Entwicklung“ („a hitújítás magyarországi elterjedésének reális alapjai […] a városokban, a polgári fejlődésben találhatók meg…”). Obwohl neuere Forschungsergebnisse diese Behauptung aus verschiedenen Aspekten tönen, ergänzen und korrigieren, bleibt jedoch Tatsache, dass das deutschsprachige Bürgertum der königlichen Freistädte in der Verbreitung der Reformation in Ungarn eine führende Rolle spielte und die ersten Vertreter von Luthers Lehre entstammten vor allem den Bürgerfamilien Ungarns. Königin Maria selbst wählte sich zum Hofprediger Johannes Henckel aus Leutschau, der von Luther beeinflusst eine Reform der Kirche antrieb.
Die Rolle der Städte in der Reformation Ungarns ist zwar nicht zu bestreiten, der Prozess ihres Konfessionswechsels ist aber bis jetzt detailliert nicht untersucht worden. Die Reformation der deutschen Reichstädte hat man mehrmals bearbeitet und beschrieben. Diese Ergebnisse und methodische Verfahren können in der Forschung ähnlicher Prozesse in den ungarischen Freistädten maßgebend sein. Im ersten Jahr des Projekts machten wir Archivforschungen in Eperies, Kremnitz, Kaschau, Bartfeld, Pressburg und Tyrnau. Wir waren bestrebt, die Quellen der gegebenen Epoche in diesen Archiven vollständig zu erschließen, also nicht nur die Korrespondenz, die Befehle und Verordnungen haben wir durchgesehen, sondern auch die Stadtbücher und Stadtrechnungen. Die letzteren haben oft ein in den Missiles vorkommende Ereignis ergänzt oder präzisiert.
Im Laufe des Projekts sind uns zahlreiche Schwierigkeiten begegnet und werden noch begegnen. Als erstes hat sich das Problem gestellt, dass wir keinen städtischen Beschluss gefunden haben (und vielleicht nie finden werden), in dem der Stadtrat deklariert, in der Zukunft nur und ausschließlich reformatorische Prediger anstellen zu wollen. Für die Anfangsphase sind daher ungewisse Konturen charakteristisch. Der Konfessionswechsel ging erst langsam, vorsichtigen Schritts, durch die Veränderung der Überzeugungen von Einzelpersonen vonstatten, wie das mindestens die bisher erschlossenen Quellen bezeugen. Für mich, den Stadthistoriker, der ich früher kirchenhistorische und theologiegeschichtliche Aspekte außer Acht gelassen habe, bedeutet all das neue, spannende geistige Herausforderungen.
Vor der ersten Forschungsreise nach Eperies haben wir natürlich die einschlägige Fachliteratur studiert, die ältere positivistische Konfessionsgeschichte genauso wie die methodisch anspruchsvolleren Studien jüngeren Datums, vor allem die Arbeiten von Zoltán Csepregi, Gabriella Erdélyi und Barnabás Guitman. Der Briefwechsel zwischen Stadtrat und neugläubigen Geistlichen datiert in groben Zügen Zeitphase und Periodisierung des Konfessionswechsels eindeutig. Trotzdem bieten solche Forschungsprobleme wie religiöse Überzeugung der Einzelpersonen noch immer wenig sichere Anhaltspunkte. Der Forscher muss hier im Dunkeln tappen, gleichzeitig kann sich er aber über kontinuierliche geistige Herausforderungen freuen.
Im nachfolgenden Teil meines Vortrags möchte ich Ihnen diese Eindrücke und die während der Forschung erfahrenen Besonderheiten mitteilen mit der Einräumung, dass ich selbst ein Stadthistoriker und kein Kirchenhistoriker bin und dass die von mir gestellten Fragen eher historisch als theologisch anmuten.
Die um das Jubiläum 1917 erschienenen Monographien über Kirchengemeinden sowie die Früchte einer regen Kirchengeschichtsforschung behandeln oft Stadtgemeinden und Kirchen der ehemaligen königlichen Freistädte. Kein Wunder, wenn man in Betracht zieht, dass eben Stadtarchive an diesbezüglichem Quellenmaterial am reichsten sind. Unter diesen Monographien zeichnen sich neben anderen die von János Breznyik über Schemnitz und József Schrödls Arbeit über Pressburg, aber besonders Sándor Payrs Ödenburg-Buch aus. Diesen drei Verfassern ist dank ihrer Mühe und Sorgfältigkeit gelungen, die Archivalien über die Anfangsphase der Reformation zu erschließen, so man kann die Reformation dieser Städte zwar in einer überholten Auffassung, aber datenmäßig genau nachlesen. Nicht einmal diese Werke sind nämlich frei von konfessioneller Engsichtigkeit und von dem Zeitgeist geleitet verirren sich ihre Autoren oft auf Holzwege.
Die frische Literatur bahnt einen neuen Weg in der Frage des Konfessionswechsels für die Forschung, indem sie den theologischen und entstehungsgeschichtlichen Hintergrund der wichtigsten Dokumente untersucht und nuanciert darstellt, aber vor allem die vielschichtige Tätigkeit der Schlüsselpersönlichkeiten – über ihre Biographie hinaus – analysiert. Eine monumentale Leistung dieser letzteren Richtung ist die Zusammenstellung und Online-Publikation eines Pfarrerbuches getitelt „Ev.-lutherische Geistliche in Ungarn“ („Evangélikus lelkészek Magyarországon, ELEM”). Die in diesem Vortrag dargestellten Probleme fußen neben der erwähnten Archiverschließung auf diese Studien.
Eine Schlüsselfrage der Reformation in den königlichen Freistädten ist die ständische Sonderstellung, die Selbständigkeit dieser Orte. Im Falle dieser Städte bedeuteten die freie Pfarrerwahl und das eigene Patronatsrecht der Kirchen einen Grund zur kirchlichen Selbstbestimmung. Diese Rechte ermöglichten den Stadträten von den königlichen Freistädten Ungarns, die Konfession selbst zu wählen. Die Zentralmacht erschien hier bis zum letzten Drittel des 17. Jahrhunderts sehr selten, um ihren Einfluss und Wille auch im örtlichen Bereich durchzusetzen. In Ungarn war es nämlich (den österreichischen Erbländern gegenüber) nicht üblich, dass an den städtischen Neuwahlen der von Herrscher ausgesandte Eidkommissar teilnahm, der die Person und Macht des Herrschers verkörperte und durch seine Anwesenheit dessen Willen in Geltung brachte.
Neben der Selbstbestimmung spielten in der städtischen Reformation die mit dem Reich gepflegten engen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen eine bedeutende Rolle. Außerdem kann man einen Einfluss der Bettelorden, in Ungarn besonders der Franziskaner, auf die frühe Reformation und die Reform der herkömmlichen Kirche nicht leugnen. Diese Bettelorden wirkten von alters her im städtischen Milieu und genossen da ein ziemliches Ansehen.
Ein großer Teil der Städte suchte dank diesem Hintergrund im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts fast überall nach neugläubigen Predigern und mit etwas Glück und nicht wenig Geld konnte man auch solche Geistliche finden, aber bis zum endgültigen Konfessionswechsel wurden noch einige Jahrzehnte gebraucht. Dieser Wechsel fand aber in der Tat in den meisten Städten statt, aufgrund der bisherigen Untersuchungen kann man sowohl in den oberungarischen Freistädten als auch in den niederungarischen Bergstädten solche Wende eindeutig feststellen.
Ödenburg und Pressburg geben aber hier ein anderes Bild ab. In diesen Städten haben mehrere Faktoren verursacht, dass die altgläubige Kirche ihre Positionen (mindestens im Sinne der Machtausübung) hier bewahren konnte. Einer von diesen Faktoren war ihre geographische Lage in Wiens Nähe, darum konnte sich der Wille des Herrschers hier viel erfolgreicher durchsetzen, als in den vom Machtzentrum entfernten Orten des Königreichs Ungarn und der Habsburgermonarchie. (Diese Beobachtung trifft auch dann zu, wenn im Falle der niederungarischen Bergstädte einen endgültigen Konfessionswechsel festgestellt werden kann, wo jedoch als im Zentrum der Edel- und Buntmetallproduktion eine viel stärkere staatliche Verwaltung zugegen war.) In Pressburg nämlich nahm neben Staat und Herrscher auch der Erzbischof von Gran an der Administration unmittelbar teil, während in Ödenburg der Bischof von Raab im untersuchten Zeitalter dauerhaft eine entschlossene Kirchenpolitik vertrat.
Ein erstes Zeichen des Konfessionswechsels kann sein, wenn ein neugläubiger Prediger in der Stadt angestellt wird oder der Rat einen regen Briefwechsel um eines gewünschten Theologen willen pflegt oder Ratsmänner viel Zeit opfern und eine lange Reise riskieren, um einen Kandidaten persönlich zu treffen (hier kommen die Eintragungen in den Rechnungsbüchern zu Wort). Falls aber der Forscher in der Theologiegeschichte nicht erfahren genug ist, kann er sehr schwierig entscheiden, ob der berufene Pfarrer alt- oder neugläubig ist. In dieser Frage können einen die Briefformeln orientieren, auf die Zoltán Csepregi in seiner Monographie aufmerksam macht. Die Briefanfänge „Gratiam et pacem…” oder „Gnad und Fried in Christo Jesu” weisen fast immer sicher den Kleriker, der sich an den Stadtrat gewandt hat, als einen Lutheraner aus. In der älteren Geschichtsschreibung hat man als solche Kennzeichen auch die Ausdrücke wie „predicator“ oder „concionator“, „verbi divini minister“ oder „minister Dei” behandelt, was in den meisten Fällen tatsächlich zutreffen kann, aber auch wir haben Quellen gelesen, in denen ein mit diesen Worten bezeichneter Kleriker eindeutig römisch gesinnt war.
Im Laufe der Quellenerschließung stellt sich fast spontan die Frage: Wodurch wurde der Rat in seinen Entscheidungen motiviert, sich an die Lehre von Luther und Melanchthon anzuschließen und einen Prediger dieser Gesinnung anzustellen? Die Antwort auf diese Frage ist sehr schwierig, zumal die Quellen keinen eindeutigen Grund oder keine eindeutige Ursache angeben. Neben den theoretischen, oft gekünstelt anmutenden Argumenten der älteren Literatur taucht natürlich auch die Kirchenkritik als ein wesentlicher Zug der Reformation auf.
Darüber hinaus gelangten auch bedeutende Vermögensobjekte in den Besitz der Städte. Die Pfründe, Schulstiftungen, kirchliche Immobilien nahmen nämlich im Laufe einer Säkularisation die Stadt und der Stadtrat in Besitz und in eigene Verwaltung. Finanzielle Fragen haben sich bereits am Anfang gestellt, denn die Stadträte haben recht früh die Zehntfrage erwogen. Im Falle der oberungarischen Freistädte führten Bartfeld, Eperies, Zeben und Kaschau bereits 1528 eine rege Korrespondenz, ob sie einen Zehnten aus den städtischen Besitztümern schuldig sind oder nicht. Nach vorübergehender Ungewissheit kam es zu einem Kompromiss mit der Hierarchie. Die Städte haben in der Regel die Dezime ihrer eigenen Herrschaften gepachtet und diese Zehntpacht der Diözese eingezahlt.
Für die Übergangsphase ist das Nebeneinanderleben von den Vertretern der römischen Kirche und dem an seiner Stelle verharrenden altgläubigen Pfarrer sowie den neugläubigen Geistlichen in mehreren Städten charakteristisch. Obwohl es Daten gibt, dass in den 1530er Jahren die Vertreter der Papstkirche manchmal misshandelt wurden, kam es trotzdem bis zur Mitte des Jahrhunderts zu keiner eindeutigen Gewaltanwendung, die der herkömmlichen Religionsausübung in den meisten Städten schließlich ein Ende gemacht hat.
Auch das Stadtbürgertum hätte eine rasche Veränderung in der Frömmigkeit und im Gottesdienst nur schwierig vertragen. Dieser allmähliche Übergang war dadurch erleichtert, dass die meisten Städte Ungarns der mäßigeren Lutherisch-Melanchthonschen Richtung folgten, d.h. die innere Ausstattung der Kirchen – darunter die wunderschönen spätgotischen Hochaltäre von Leutschau, Kaschau und Bartfeld – erhalten blieb. Die Schwierigkeiten des Übergangs bezeugt der Fall von Esaias Lang, Pfarrer in Bartfeld, der recht früh, am Anfang der 1530er Jahren mitsamt seiner Familie ins Pfarrhaus einzog. Eine Priesterehe wirkte aber anstößig in den Augen vieler Bürger, darum (und auch auf einen Befehl des Herrschers hin) musste Lang die Stadt verlassen.
Der letzterwähnte Fall zeigt, dass die 1530er Jahre bereits einen anfänglichen Erfolg vom Drang seitens der Kirchenmacht bezeugen. Ab Anfang 1530 finden sich in fast jedem Stadtarchiv strenge Befehle von Pál Várdai, Erzbischof von Gran, die die lutherischen Prediger einer teuflischen Ketzerei anklagen und des Landes verweisen. Tamás Szalaházy, Bischof von Erlau, schloss sich an ihn, indem er 1531 die oberungarischen Städte zu einer Konsultation einlud, wo es vor allem um eine durch erzbischöfliche Kommissare durchgeführte Kirchenvisitation ging.
Bald tauchen Informationen auf, dass „katholisch“ gebliebene Kirchenpatrone gegen evangelische Geistliche auftraten. 1532 sind Prediger und Schulmeister aus Salzburg, Scharoscher Komitat, wegen grundherrlichen Grausamkeiten von Ferenc Soós geflüchtet und immer mehr Glaubensflüchtlinge kamen nach Bartfeld. In dieser Lage suchten die Städte eher verzweifelt nach Pfarrkandidaten, weil die Prediger aus Ungarn mehr in Richtung Schlesien vor den Drohungen gewichen sind.
Unter den erschlossenen Quellen finden sich mit der Zeit immer mehr Briefe, in denen der Stadtrat Kleriker mit entsprechender Lehre sucht. Aus der Korrespondenz geht hervor, dass oft ohne Erfolg. Die oberungarischen Städte, aber auch das zur Residenzstadt Wien und zum Sitz des Graner Erzbischofs nahe liegende Tyrnau versuchten ihre Geistlichen teilweise aus Niederungarn zu rekrutieren, weiter spielte im Pfarrernachschub die Wittenberger und Brieger Ordination eine große Rolle, woher Theologen manchmal mit der Empfehlung Melanchthons nach Ungarn gekommen sind.
Zu den aus dem deutschen Sprachgebiet gekommenen Geistlichen zählen sich auch solche Feldprediger, die mit den im Reich geworbenen und aus Wien bezahlten Truppen in den ungarischen Thronstreit zwischen den Königen Ferdinand I. und Johannes I. gekommen sind. Es gibt auch Daten, die über eine Ausscheidung (Apostasia) von Mönchen oder katholischen Weltpriestern bezeugen. Im Falle der bisher erschlossenen Stadtarchive aber zeichnet sich vor allem eine Rolle der Schlesischen Prediger aus.
Im Laufe der nachfolgenden Jahrzehnte kehrt diese Tendenz um und sowohl Übergangsphase als auch Konfessionswechsel schließen sich in den städtischen Quellen eindeutig ab. In den untersuchten Städten – auch in Ödenburg und Pressburg, wo sich die Hierarchie halten konnte – nimmt die Zahl der Messpriester und Mönche ab. Diese Erfahrung untermauern auch die Kirchenordnungen, die in der Mitte des Jahrhunderts im evangelischen Geiste zusammengestellt worden sind.
Auch die Frage der Benefizien und des Kirchenbesitzes ist immer mehr in den Vordergrund gerückt. Man kann in der Tat die städtische Inbesitznahme des ganzen kirchlichen Vermögens als den sicheren Termin betrachten, ab wann der Konfessionswechsel als abgeschlossen gilt. Dieser Prozess hing allenfalls mit dem Reichsrecht zusammen, vor allem mit der Inbesitznahme der städtischen Ordensvermögen.
Während es 1532 in Kaschau noch Altaristen gibt, sind in den 1550er Jahren die Altarpfründen in die Verwaltung des Stadtrats gelangt. Heute kennt man das Drehbuch vom Abbau des alten Kirchenwesens in Kaschau am genauesten. Hier haben zwei Faktoren, ein politischer Grund und ein Feuerbrunst, im Konfessionswechsel dem Stadtrat Abhilfe geleistet. Nachdem (laut Übereinstimmung zwischen Ferdinand und der verwitweten Königin Isabella) das von König Johannes 1536 eroberte Kaschau wieder unter Ferdinands Herrschaft kam und das von Johannes vertriebene deutsche Bürgertum zurückkam sowie die aus Pest und Szegedin vor den Osmanen hierherziehenden Kaufleute die Stadt sowohl wirtschaftlich als auch reformatorisch verstärkten, wurde die Frage der Konfessionswahl endgültig beantwortet.
Das Bürgertum von Kaschau hat den Dominikaner János Kolozsvári noch vor 1553 einfach aus der Stadt vertrieben. 1553 aber kam es zur Konfiszierung der Besitztümer der Dominikaner, die auch Georg Werner, Präsident der Zipser Kammer, bewilligte, indem er das ganze Ordensvermögen, Mobilien und Immobilien entgegennahm und dem Stadtrat übergab. Ein anderer Faktor war der Feuerbrunst, der neben anderen Häusern auch die Gebäude der Franziskaner beschädigte, die daher Kaschau verließen. Ähnlicher Weise flüchtete der letzte Stadtpfarrer, Ferenc Mohi, nach dem benachbarten Szikszó. Aus diesem Anlass hat die Stadt die Ausstattung der St. Elisabeth Pfarrkirche (dem heutigen Dom) ins Inventar aufgenommen, d.h. in städtischen Besitz übernommen.
Genau zu dieser Zeit wurde Kaschau zu einem militärischen Verwaltungszentrum. Darum konnte der Stadtrat im Dominikanerkloster eine evangelische Schule nicht mehr unterbringen, weil dieses zu einem Militärmagazin umgewandelt wurde, während man die Mühle der Dominikaner zur Verpflegung der Ortsgarnison verordnete. Die Stadtkirchen und der Gottesdienst sind nach der Übernahme des Kirchenvermögens doch evangelisch geworden, so hat der Stadtrat dessen Einkünfte verwaltet und aus diesen die kirchlichen Tätigkeiten finanziert.
István H. Németh (MNL OL)